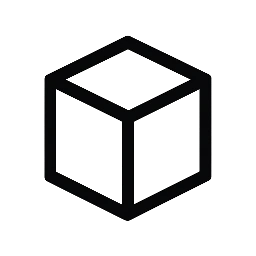Kategorien >> Militär & Waffen >> Uniformen & Auszeichnungen >> Uniformen nach Nation / Epoche >> Spezielle historische & konfliktbezogene Uniformen >> Kriegsgefangenenlager & Internierung >> Erster Weltkrieg (1914–1918)
Erster Weltkrieg (1914–1918) – Kategorien
In den Kriegsgefangenenlagern des Ersten Weltkriegs trugen die Internierten in der Regel ihre ursprünglichen Militäruniformen, oft stark abgetragen und notdürftig repariert. Um Fluchtversuche zu erschweren, wurden vielerorts auffällige Markierungen angebracht, etwa farbige Stoffstreifen, aufgenähte Buchstaben oder Schnitte in der Kleidung. Zivile Ersatzkleidung wurde nur selten ausgegeben und war meist einfach, grob und schlecht angepasst. Insgesamt spiegelten die Uniformen und Kleidungsstücke der Gefangenen die Versorgungsengpässe und restriktiven Bedingungen der Lager wieder.

Alle Erster Weltkrieg (1914–1918) – Typen

Deutsche Kriegsgefangenenlager (Stalag-Vorgänger)
Deutsche Kriegsgefangenenlager im Ersten Weltkrieg, die später als Vorläufer der bekannten Stalags im Zweiten Weltkrieg gelten, waren meist provisorisch angelegt und bestanden aus Baracken, Zeltlagern oder umfunktionierten Gebäuden. Die Gefangenen trugen in der Regel ihre ursprünglichen Militäruniformen, die oft schnell verschlissen waren und durch zivile oder einfache Lagerkleidung ergänzt wurden. Zur Kennzeichnung wurden Abzeichen, Stoffstreifen oder aufgenähte Nummern verwendet, manchmal auch farbige Markierungen an Jacken oder Hosen. Einheitliche Lageruniformen waren selten, weshalb das Bild von Kriegsgefangenen in dieser Zeit stark von improvisierter Kleidung, gemischten Uniformteilen und sichtbaren Kennzeichnungen geprägt war.

Britische & französische POW-Camps
Britische und französische Kriegsgefangenenlager im Ersten Weltkrieg unterschieden sich von den deutschen vor allem durch ihre oft strengere Organisation, aber auch durch eine etwas bessere Versorgungslage. Gefangene – vor allem Deutsche, aber auch Österreicher – behielten zunächst ihre eigenen Uniformen, die mit der Zeit stark abgetragen waren. In vielen Lagern wurden deshalb neutrale oder einfache Ersatzkleidungsstücke ausgegeben, meist in gedeckten Farben ohne militärische Abzeichen. Zur eindeutigen Erkennung trugen die Gefangenen auffällige Kennzeichen, wie große aufgemalte oder aufgenähte Buchstaben (z. B. „P.G.“ für Prisoner of War), Stoffstreifen oder farbige Armbinden. In britischen Lagern wurde teilweise Zivilkleidung ausgegeben, die mit speziellen Markierungen versehen war, um Fluchten zu erschweren. In Frankreich war die Versorgung oft knapper, weshalb Gefangene ihre ursprünglichen Uniformteile länger trugen und improvisierte Kennzeichnungen üblich waren.

Russische Kriegsgefangenenlager in Sibirien & Zentralasien
Russische Kriegsgefangenenlager in Sibirien und Zentralasien während des Ersten Weltkriegs nahmen hunderttausende österreichisch-ungarische, deutsche und osmanische Soldaten auf. Die Gefangenen wurden meist in sehr abgelegenen Regionen untergebracht, in provisorischen Baracken, Holzhütten oder sogar Zelten. Uniformen wurden in den Lagern oft weitergetragen, bis sie völlig verschlissen waren. Danach erhielten die Gefangenen schlichte zivile oder halbmilitärische Ersatzkleidung, die aber kaum standardisiert war. Zur Erkennung wurden einfache Kennzeichen wie Stoffabzeichen, farbige Streifen oder Markierungen auf Mützen und Mänteln verwendet. Viele Gefangene mussten harte Zwangsarbeit in Landwirtschaft, Bergbau oder Eisenbahnbau leisten, was die Kleidung schnell abnutzte und häufig improvisierte Reparaturen nötig machte. In den kälteren Regionen Sibiriens waren gefütterte Mäntel, Fellmützen und improvisierte Winterkleidung lebenswichtig, während in Zentralasien leichtere Baumwollstoffe genutzt wurden. Fluchtgefahr wurde vor allem durch die große Entfernung und fehlende Ausrüstung reduziert, weshalb die Kennzeichnungen eher schlicht gehalten waren.

Gefangenenlager im Osmanischen Reich (z. B. für Briten und Araber)
Gefangenenlager im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs dienten vor allem zur Internierung britischer Soldaten aus Mesopotamien (z. B. nach der Kapitulation von Kut 1916) sowie arabischer Aufständischer. Die Unterbringung war meist in Kasernen, improvisierten Baracken oder umfunktionierten Gebäuden, teilweise auch in Zelten. Die Gefangenen behielten oft ihre ursprünglichen Uniformen, die mit der Zeit stark verschlissen, ohne dass ausreichend Ersatz bereitgestellt wurde. Eine systematische Lagerkleidung wie in Europa war selten; stattdessen trugen die Gefangenen eine Mischung aus zivilen Stoffen, regionaler Kleidung und Resten ihrer Uniformen. Erkennungsmerkmale waren einfache Armbinden, Stoffstreifen oder Namensschilder, manchmal auch farbige Markierungen auf der Kopfbedeckung. Besonders britische Offiziere durften gewisse Uniformteile behalten, während einfache Soldaten häufiger in lokaler Ersatzkleidung herumliefen. In den heißen Regionen Mesopotamiens oder Syriens war improvisierte, leichte Kleidung verbreitet, während in Anatolien dickere Mäntel und Decken notwendig waren. Die mangelhafte Versorgung und harte Behandlung führten dazu, dass die Kleidung der Gefangenen oft zerschlissen, geflickt und sehr uneinheitlich wirkte.

Internierung von Zivilisten feindlicher Nationen (z. B. in Großbritannien und Frankreich)
Während des Ersten Weltkriegs wurden in Großbritannien, Frankreich und anderen beteiligten Staaten Zivilisten feindlicher Nationen interniert, vor allem Deutsche, Österreicher, Ungarn und später auch Osmanen. Betroffen waren Geschäftsleute, Seeleute, Migranten oder Familienangehörige. Die Internierung erfolgte in improvisierten Lagern, umfunktionierten Kasernen, Barackenlagern oder auch auf Inseln wie der Isle of Man. Die Zivilisten trugen meist ihre normale Alltagskleidung, da es keine einheitliche Lageruniform gab. Mit der Zeit wurden jedoch einfache Kennzeichen wie Armbinden, Stoffabzeichen oder nummerierte Marken eingeführt. Teilweise stellte man auch einfache Arbeitskleidung oder Mäntel, wenn die eigene Kleidung verschliss. In Frankreich wurden Deutsche und Österreicher in Lagern in der Bretagne oder Südfrankreich untergebracht; auch dort blieb die Kleidung uneinheitlich, teils ergänzt durch gefangenenähnliche Jacken oder Überwürfe. Insgesamt entstand ein Bild der Improvisation: keine standardisierte Uniform, sondern Erkennung über Abzeichen, Listen und Vorschriften.